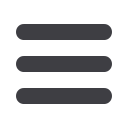

Die Erinnerung an die Wehrmacht lässt sich
nicht tilgen, aber es lässt sich daraus lernen.
Hier ein Foto aus dem Zweiten Weltkrieg:
Rekruten der Wehrmacht leisten den Schwur
auf die Reichskriegsflagge.
nahme versöhnen will, die sie für
die Wehrmachtsoffiziere im Wi-
derstand formuliert hat. Mit jeder
Henning-von-Tresckow-Kaserne,
Graf-Stauffenberg-Kaserne,
Gene-
raloberst-Hoepner-Kaserne werden
Männer heraufbeschworen, die an der
verbrecherisch enthemmten Kriegs-
führung beteiligt waren. Wollte man
die Verbrechen mit den Kasernen eh-
ren? Nein, man wollte die moralische
Karriere ehren, die Umkehr und mit
dem Hinrichtungstod beglaubigte
Buße, die diese Offiziere mit ihrer Hin-
wendung zum Widerstand vollzogen.
Das Vorbild für die Bundeswehr be-
steht in der Ermahnung, gottlose und
sittenwidrige Befehle zu verweigern,
gegebenenfalls sogar einem entgleis-
ten Staat „in die Speichen zu greifen“
(Dietrich Bonhoeffer), und zwar eher
früher als so spät, wie es die Verschwö-
rer des 20. Juli taten.
Dieses Vorbild würde aber zu den
Soldaten gar nicht sprechen, wenn
von der Wehrmacht stille geschwiegen
würde. Die Wehrmacht ist geradezu
die Folie, auf der das Selbstverständnis
der Bundeswehr entwickelt wurde und
vor der es auch heute noch verstanden
werden sollte. Insofern ist es auch nicht
von Nachteil, wenn in der Marineschu-
le Mürwik noch immer das kitschige Seestück
vom Untergang der „Bismarck“ im Mai 1941
hängt – kein Skandal, wie manche Kommentato-
ren meinen, sondern ein anschauliches Lehrstück
in doppelter Hinsicht, für militärische Führungs-
fehler, die in der menschenverachtenden Selbst-
versenkung gipfelten, und für die Sinnlosigkeit,
die der Opfertod hat, wenn die übergeordneten
Kriegsziele selbst schon menschenverachtend und
verbrecherisch sind. Aus demUntergang der „Bis-
marck“ können Bundeswehrsoldaten viel lernen,
unter anderem auch über verantwortungslose
Rüstungspolitik und Materialbeschaffung. Die
„Bismarck“ hatte bekannte technische Mängel;
schon ihre Indienststellung war zynisch.
Es ist eine reine Fiktion
Mit anderen Worten: Was das Gemälde dieses
Unglücksschiffs, was ein zerbeulter Wehrmachts-
helm, was Relikte überhaupt aus der Unheilszeit,
die hier und da gesammelt wurden, zur Anschau-
ung bringen, hängt einzig und allein von den his-
torischen Kenntnissen ab, die man den Soldaten
vermittelt hat. Wo verharmlosende Legenden
verbreitet sind, wird es nichts helfen, die Reli-
quien der Anbetung zu entziehen. Wo aber der
nationalsozialistische Abgrund aufgeklärt ist,
werden die letzten Stahlteile oder Stofffetzen, die
aus ihm noch ragen, nichts als Kummer, zumin-
dest schreckliche Ambivalenz, erzeugen. Denn
zum Letzten muss natürlich zugestanden werden,
dass es inmitten des Grauens auch militärische
Bravourstücke gab. Diese Intarsien streng von
dem überwölbenden Unheilszusammenhang zu
trennen dürfte niemand überfordern, der über-
haupt bereit ist, sich seines Verstands zu bedie-
nen. Übrigens dürfte die Vergegenwärtigung
taktischer Einzelleistungen oder folgenloser
Verantwortungsgesten eher noch die Schwermut
verstärken: Selbst das Beste wurde vergeudet und
missbraucht.
Manches spricht freilich dafür, dass die Bun-
deswehrkritiker derzeit nicht mehr bereit sind,
sich ihres Verstands zu bedienen und das eine
vom anderen zu trennen. Es wird alles verrührt
und einer panischen Logik des Verdachts ausge-
setzt. Das trotteligste Beispiel ist die Empörung
darüber, dass sich das Wachbataillon alter Wehr-
machtskarabiner beim Präsentieren bedient. Tat-
sächlich handelt es sich, moralisch betrachtet, um
eine höchst befriedigende Geste. Nichts ist bewe-
gender, als dasWachbataillonmit ebendieserWaf-
fe zur Gedenkfeier des Widerstands am 20. Juli
jeden Jahres im Bendlerblock aufziehen zu sehen.
Dass eine Wehrmachtswaffe zu Ehren derer prä-
sentiert wird, die als Verräter galten, bedeutet ei-
nen vollendeten Sieg der demokratischen Armee
über die Gespenster der Vergangenheit.
Es ist eine reine Fiktion, und lügenhaft dazu, so
zu tun, als wäre die Bundeswehr aus dem Nichts
entstanden und könnte allein aus sich heraus eine
Tradition begründen. Eine Stunde null gab es für
sie ebenso wenig wie für den Nachkriegsstaat und
die Nachkriegsgesellschaft, in denen noch lange
die Gespenster nachspukten. Aus deren Vertrei-
bung, nicht aus deren Leugnung bezieht die Bun-
desrepublik bis heute Selbstbehauptungswillen
und moralische Energie, und nicht anders kann
es für die Bundeswehr sein. Es ist ein
deutscher Sonderfall – aber unkorri-
gierbar –, dass der Abstoßungspunkt,
der Selbstbehauptung und Identität
begründet, nicht außerhalb der deut-
schen Grenzen liegt, sondern inner-
halb der eigenen Geschichte. Schon
deswegen muss sie präsent bleiben,
und meinetwegen mit einem zerschos-
senen Wehrmachtshelm in der Offi-
ziersmesse.
In einer anderen Hinsicht aber ist
die Bundeswehr kein Sonderfall, son-
dern eine Truppe wie jede andere auf
der Welt, die auf Jahrtausende des
Kriegshandwerks zurückblickt. Man
kann es verfluchen, aber so ist es nun
einmal. Wie es vor der Bundesrepu-
blik schon andere deutsche Staaten
gab, zu Zeiten sogar im Überfluss, gab
es auch vor den Bundeswehrsoldaten
andere deutsche Soldaten. Auch die
Landsknechte Georgs von Frunds-
berg, die den Papst 1526 bei Brescia schlugen,
waren deutsche Soldaten, auch die hessischen
Landeskinder, die seit 1776 in englische Dienste
verkauft wurden, auch die bayerischen Artilleris-
ten, deren Erfolg bei Sedan 1870 Napoleon III.
zur Abdankung zwang. Alle diese bilden den his-
torischen Horizont selbst einer demokratischen
Bundeswehr, einschließlich der Lebensbilanz
Frundsbergs: „Drei Dinge sollten jedermann vom
Krieg abschrecken: die Verderbung und Unter-
drückung der armen, unschuldigen Leute, das
unordentliche und sträfliche Leben der Kriegs-
knechte und die Undankbarkeit der Fürsten.“
Es wäre gewiss nicht hilfreich – und weltfremd
dazu –, Soldaten der Bundeswehr durch einen
verschärften Traditionserlass vor Einsichten des
sechzehnten Jahrhunderts zu bewahren, die ge-
rade eben noch, in den Jugoslawienkriegen der
1990er Jahre, ihre Aktualität bewiesen haben.
Noch weniger hilfreich wäre – und unschön dazu
–, wenn sich Regierung und Öffentlichkeit der
Bundesrepublik die Undankbarkeit der Fürsten
zueigen machten. Die Soldaten sind nicht nur
bereit, in unserem Auftrag zu töten, sie sind auch
bereit, dabei zu sterben. Man muss es nicht feiern;
aber es ist auch keine Kleinigkeit.
Der Journalist und Publizist
Jens Jessen
ist als
Redakteur im Ressort Feuilleton der „Zeit“ tätig.
Der Artikel erschien inAusgabe 22/2017 der „Zeit“.
Foto: SZ Photo
DIE BUNDESWEHR | JULI 2017
T I T E L : B E R U F S E T H O S 33
















