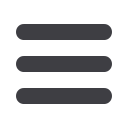

Foto: Bundeswehr/Schrief
Die Bevölkerung
sieht den Sol-
daten zuerst als
Schützer, Helfer,
wie hier beim
Hochwasser-
einsatz 2013.
der Politik, Gehorsamspflicht und seine Grenzen,
Kameradschaft, Wahrheitspflicht), die Parla-
mentsarmee. Soldat für den Rechtsstaat und im
Rechtsstaat, Soldat zur Friedenssicherung.
Diese Normen sind die fundamentale Lehre
aus dem kollektiven Trauma des deutschen An-
griffskriegs gegen die europäischen Nachbarn,
als die Wehrmacht williges Werkzeug eines gi-
gantischen Staatsverbrechens und Wegbereiter
von Völkermorden wurde, als soldatische Tugen-
den pervertiert wurden. Die Wertebindung ist
eine Absage an den Krieger und Söldner. Dieser
komplexen und hohen Anforderungen heutiger
Kriseneinsätze der Gesellschaft zu vermitteln.
Im Einsatz richtig gehandelt
Nach mehr als zwanzig Jahren deutscher Beteili-
gung an internationalen Kriseneinsätzen ist de-
ren Bilanz gemischt: Die Soldaten meisterten die
enormen Anforderungen sehr professionell und
diszipliniert, mit hohem Einsatz, viel Umsicht
sowie interkultureller Kompetenz. Bei örtlichen
Bevölkerungen erwarben sie sich durchweg einen
guten Ruf. Die Untersuchungen der G36-Kom-
dung. Damit wuchs die Distanz zu einer in ihren
politischen Erwartungen gewaltabstinenten Ge-
sellschaft. Vor allem die verantwortliche Politik
sah da lieber weg, ließ die Einsatzsoldaten zu lan-
ge allein – oder nahm sie „nur“ als Verwundete
und Gefallene, kaum als Kämpfer war. „Tatorte“
stellten Einsatzrückkehrer immer wieder unter
Verrohungsverdacht (Befragungen von Bundes-
wehrsoldaten widersprachen dem). Gegenüber
ihren elementaren Grundbedürfnissen nach
Sinn, Zusammenhalt, Identifikation, Vorbildern
und Orientierung blieben Politik sowie Gesell-
schaft stumm. Das beförderte eine „Privatisie-
rung“ der Suche nach eigenen Leitbildern. Hier
müsste nicht zuletzt eine zeitgemäße Traditi-
onspflege ansetzen, die sich viel mehr aus den 60
Bundeswehrjahren speisen kann.
Was schulden Gesellschaft und
Politik den Soldaten?
Zu allererst Aufmerksamkeit, Interesse, genaueres
Hinsehen. Alle Bürger müssten, unabhängig von
ihrer Haltung zu Militär allgemein, ein Interesse
daran haben, dass die Bundeswehr in Gesellschaft
und Rechtsstaat integriert ist. Kommunikation,
Diskussion, Streit ja, Ausgrenzung nein!
Respekt und Dank wird den Soldaten im Bun-
destag oft und fraktionsübergreifend ausgespro-
chen. Das ist auch ehrlich gemeint. Aber es muss
sich auch in der politischen Praxis niederschla-
gen: Bundesregierung und Bundestag stehen in
der Pflicht zu klaren, erfüllbaren sowie glaub-
würdigen Aufträgen. Einsätze müssen Aussicht
auf Erfolg haben und Sinn ergeben. Das betrifft
die Ziele wie die Mittel. Die politische Führung
muss überzeugen können, um Handeln aus Ein-
sicht zu ermöglichen. Das geht nur mit Ehrlich-
keit, Konsequenz, mit einer Fehler- und Vertrau-
enskultur. Innere Führung fängt oben an. Die
unangenehme Wahrheit: Über Jahre verlorenes
Vertrauen muss zurückgewonnen werden.
Der Primat der Politik braucht das freie Wort
von Staatsbürgern in Uniform auch in der Öf-
fentlichkeit. Politik muss das endlich ermutigen
statt sanktionieren.
Der deutsche Politiker
Winfried Nachtwei
(Bündnis 90/Die Grünen) ist Experte für
Friedens- und Sicherheitspolitik.
Winfried
Nachtwei
Foto: privat
Rahmen ist in Politik und Gesellschaft weitge-
hend unstrittig.
Die Bundeswehr soll in die Gesellschaft inte-
griert sein. Insofern spiegeln sich in ihr selbstver-
ständlich auch gesellschaftliche Entwicklungen.
Als Träger des rechtsstaatlichen Gewaltmono-
pols nach außen müssen Bundeswehrsoldaten
aber höheren Ansprüchen genügen als die „Nor-
malbürger“. Fremdenfeinde und Gegner der
Verfassungsordnung haben in der Bundeswehr
nichts zu suchen.
Nach Ende des Kalten Kriegs haben sich die
sicherheitspolitischen Rahmenbedingungen
und die damit einhergehenden Anforderungen
an Soldaten erheblich verkompliziert sowie auf-
gefächert: Die Abschreckungsarmee mit Vertei-
digungsauftrag wurde zur Einsatzarmee. Statt
„Kämpfen können, um nicht kämpfen zu müs-
sen“, heißt es bei Kriseneinsätzen „Kämpfen kön-
nen, um bei Bedarf erfolgreich zu kämpfen“. Im
Feld müssen militärische, zivile und polizeiliche
Akteure zusammenwirken.
Zugleich driften die Erfahrungswelten der
Einsatzsoldaten mit ihren jeweils sehr unter-
schiedlichen Verwendungen und der friedens-
gewohnten Heimatgesellschaft auseinander.
Immer weniger Menschen in Deutschland haben
persönlichen Kontakt mit Bundeswehr und Sol-
daten. Einsatzrückkehrer empfinden „zu Hause“
viel mehr Desinteresse als Aufmerksamkeit, gar
Unterstützung. Stellenweise erleben Soldaten in
der Zivilgesellschaft massive Ablehnung, gar Be-
leidigung.
Der Politik gelang es bisher nur unzureichend, die
mission ergaben, dass der Schusswaffeneinsatz
bei den allermeisten Einsätzen minimal und das
Gefechtsverhalten in der Kriegsphase des Af-
ghanistaneinsatzes bemerkenswert kontrolliert
war. Auf der taktischen Ebene waren die Bundes-
wehrsoldaten ihren Gegnern ab 2010 durchweg
überlegen. Wer als Nichtmilitär Bundesehrsolda-
ten im Einsatzgebiet traf, war von deren Selbst-
verständnis immer wieder angetan.
Anders sieht es mit dem Einsatzerfolg im
Großen aus: Die im Sinne des Auftrags Kriegs-
verhütung erfolgreichen und gewaltarmen Bal-
kaneinsätze sind überwiegend „vergessen“. Beim
Afghanistan-Einsatz bestand die Bundeswehr
ihre bisher härteste Bewährungsprobe. Aber: Das
militärische Einsatzziel von ISAF, ein sicheres
Umfeld zu hinterlassen, wurde wegen politischer
Großfehler beim Gesamteinsatz der internatio-
nalen Koalition nicht erreicht. Einsatzrückkeh-
rer sind jetzt mit dem nachträglichen Sinnverlust
ihres Einsatzes konfrontiert – und damit allein.
Als die deutschen ISAF-Soldaten ab 2007
mit immer mehr Hinterhalten, Anschlägen und
wucherndem Guerillakrieg konfrontiert waren,
wurde das von der politischen Führung ignoriert
sowie schöngeredet. Wo der Stabilisierungsauf-
trag von der Lageverschärfung konterkariert
wurde und an Glaubwürdigkeit verlor, waren die
Einsatzsoldaten draußen zunehmend auf sich
selbst zurückgeworfen: auf ihre Professionalität,
auf die Kameradschaft der kleinen Kampfge-
meinschaft. Die Gefechtssoldaten agierten im
scharfen Kernbereich des Soldatenberufs, der
staatlich organisierten tödlichen Gewaltanwen-
DIE BUNDESWEHR | JULI 2017
T I T E L : B E R U F S E T H O S 31
















