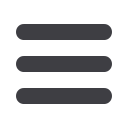

sondere Form der Kameradschaft in der kleinen
Kampfgemeinschaft, die Erwartung auf zumin-
dest den Respekt der eigenen Bevölkerung sowie
die offensichtliche Notwendigkeit für Vorbilder
gehört. Und zwar nicht nur im deutschen Heer,
sondern in allen Landstreitkräften weltweit.
Eben ein strukturelles Phänomen. Es ist äußerst
schwierig, all diese Elemente anzusprechen, ohne
dabei in ein Pathos zu
verfallen oder sie ide-
ell zu überhöhen. Aber
diese Schwierigkeit
führt nicht dazu, dass
die Punkte weniger
richtig werden.
Wozu all diese Ab-
leitungen und Ge-
danken? Nun, zum
Foto: dpa/picture alliance
Generalleutnant Jörg Vollmer, hier beim Besuch der Soldaten des Jägerbataillons 291
Von den Streitkräften wird verlangt, unter Einsatz des eigenen Lebens einen Gegner auch
mit archaischen Methoden zu besiegen. Hier: Peschmerga-Ausbildung im Irak
Die Soldaten des Heeres
blicken im Gegensatz zu
anderen Teilstreitkräften
auch immer wieder in
die Waffenmündung des
Gegners.
GENERALLEUTNANT JÖRG VOLLMER
Die Offensive „Gutes Führen“ des Heeres zielt ge-
nau auf diese Aktivierung.
Die Traditionsdebatte zieht sich wie ein roter
Faden durch die Geschichte der Bundeswehr und
der Bundesrepublik Deutschland. Eine breit an-
gelegte Diskussion ist jetzt zur Überarbeitung
des Erlasses initiiert. Das Heer wird diesen Pro-
zess aktiv begleiten und durch ein eigenes Projekt
flankieren. Damit wollen wir versuchen, uns dem
Wesenskern soldatischen Daseins, dem Kampf,
zu nähern und Ableitungen hinsichtlich der Not-
wendigkeit traditionsstiftender Identifikations-
oder Bezugsmodelle zu erarbeiten.
Warum gehen wir diesen Weg? Von Streit-
kräften wird verlangt, einen Gegner in letzter
Konsequenz physisch an der Ausführung seines
Auftrags und zwar mit militärischer Gewalt zu
hindern. Die möglichst professionelle, diskri-
minierende und präzise
Anwendung militäri-
scher Gewalt gehört also
zur „Essenz der Dinge“
von Streitkräften. Fo-
kussiert auf die Welt des
Heeres beziehungsweise
der Landstreitkräfte er-
folgt diese Anwendung
militärischer Gewalt als
besonderes Alleinstel-
lungsmerkmal stets in-
mitten von Menschen.
Menschen, von denen
die Masse nicht zum
Gegner, sondern zur zu
beschützenden Bevölke-
rung gehört. Menschen,
die bewusst als Schutz-
schilder zur Provokation
von sogenannten Civil
Casualities benutzt werden. Menschen, unter
denen asymmetrische oder verdeckt operierende
Kämpfer für unsere Soldaten unentdeckbar ver-
schwinden können.
Auch wenn die Soldaten des Heeres ebenfalls
in Waffensystemen sitzen, „Knöpfe drücken“
und dabei „in Bildschirme schauen“, blicken sie
im Gegensatz zu anderen Teilstreitkräften aber
auch immer wieder in die Waffenmündung des
Gegners, in die Gesichter der betroffenen Bevöl-
kerung oder direkt in die Augen des Feindes. Die
Heeressoldaten sind da. Unter den Menschen. 24
Stunden. Oft über Monate, über Jahre, manch-
mal Jahrzehnte.
Genau das kann beim Heeressoldaten dann zu
einer immer größer werdenden „Schere“ führen
zwischen einer auf Selbstoptimierung ausgerich-
teten postheroischen Gesellschaft und der Not-
wendigkeit, unter Einsatz des eigenen Lebens
– oder das seiner Kameraden – einen Gegner ge-
gebenenfalls auch mit archaischen Methoden zu
besiegen. Es gehört zur „Essenz der Dinge“, dass
auch in einer „Unter dem Strich, zähl ich“-Gesell-
schaft nur der besser ausgebildete Soldat in einer
Duellsituation überlebt.
Genauso gehört es zum unveränderlichen We-
senskern von Streitkräften, dass dazu eine be-
Das Heer wird im engen Schulterschluss mit den
anderen Teilstreitkräften und Organisationsbe-
reichen den Prozess der Umsetzung sowie Erar-
beitung des Fähigkeitsprofils der Bundeswehr
dazu nutzen, die bisher eingeleiteten Trendwen-
den, den Materialzulauf, die notwendige Moder-
nisierung und Digitalisierung des Heeres sowie
die notwendige Verbesserung unterstützender
sozialer Rahmenbedingungen so miteinander zu
verknüpfen, dass ein permanenter und schrittwei-
ser Fähigkeitsaufwuchs über den Weg personell
sowie materiell voll alimentierter Kräftedisposi-
tive erreicht werden kann. Entscheidend ist es,
den Angriffsschwung nicht zu verlieren. Dazu
aber müssen die immer noch gültigen Drosse-
lungen bei der Beschaffung 2018 aufgehoben
werden. Quantität wird noch eine geraume Zeit
die neue Qualität sein. Das Fähigkeitsprofil ist in
meinen Augen die große Chance, das Heer und
die Landstreitkräfte zielführend, koordiniert so-
wie harmonisiert wieder an ihre „Essenz der Din-
ge“ heranzuführen.
einem um deutlich
zu machen, wie groß
das Spannungsfeld
zwischen den Ent-
wicklungen unserer
Gesellschaft und dem
Wesen unserer Auf-
tragserfüllung ist. Um
aufzuzeigen,
welch
große Leistungen un-
seren Soldatinnen und
Soldaten auf allen Ebe-
nen immer wieder aufs
Neue abverlangt werden. Zum anderen, um zu
zeigen, welche Aufgabe den politischen, aber auch
militärischen und zivilen Entscheidern in diesem
Kontext zufällt. Diese haben nämlich sicherzu-
stellen, dass die inneren und äußeren Faktoren
so ausgestaltet werden, dass die Streitkräfte ihren
Kernauftrag auch glaubhaft erfüllen können.
Dazu gehören unter anderem robuste Personal-
strukturen, vor allem qualitativ und quantitativ
ausreichendes Material sowie attraktive Rah-
menbedingungen des Dienens als Grundvoraus-
setzungen zur Erfüllung unserer Aufgaben als
deutsches Heer. Viel ist erreicht worden durch die
eingeleiteten Trendwenden.
Foto: Bundeswehr/Schulz
DIE BUNDESWEHR | JULI 2017
T I T E L : B E R U F S E T H O S 27
















