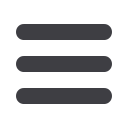

oben übersteuert worden. Zu den größten Errun
genschaften der Wehrgesetzgebung nach dem
Krieg gehört daher die Regelung, wonach die
Entscheidung des zuständigen Disziplinarvorge
setzten von keinem Vorgesetzten mehr verändert
werden kann, weder abgemildert noch verschärft.
Ein höherer militärischer Vorgesetzter kann das
Verfahren auch nicht erneut aufrollen. Der Grund
dafür ist die Erfahrung, dass höhere Komman
dobehörden dazu neigen, der Abschreckung mehr
Bedeutung beizumessen als der individuellen
Würdigung; ein „Exempel zu statuieren“. Beson
ders in totalitären Systemen, aber nicht nur dort.
Ministerin von der Leyen möchte jetzt offensicht
lich zu den Regelungen vor 1945 zurückkehren.
Verwechselt werden häufig Dienstvergehen und
Wehrstraftaten. Letztere bieten keinem Vorge
setzten Ermessensspielraum. Jeden Verdacht hat
er den zuständigen Stellen zu melden. Unterlas
sung ist strafbar. Wenn in aktuellen Fällen vom
Verteidigungsministerium oder in der Öffent
lichkeit gefordert wird, „härter durchzugreifen“,
so liegt dem offenbar die Befürchtung zugrunde,
unterschätzt oder nicht erkannt wurde, ist natür
lich. Die Unterstellung eines systematischen Vor
satzes, aus Korpsgeist, Kameraderie, Sympathie
oder umMissstände zu verschweigen, wenn nicht
zu decken, enthält den ehrverletzenden Vorwurf
einer Pflichtverletzung. Die Unterscheidung, was
erzieherisch, was disziplinar zu regeln und was
in die Zuständigkeit der Justiz fällt, wird in der
Bundeswehr seit Anbeginn sicher beherrscht so
wie gehandhabt. Zweifelsfälle oder Fehleinschät
zungen bilden dazu keinen Widerspruch.
Was indessen die politische Öffentlichkeit aus
unterschiedlichsten Beweggründen regelmäßig
auf den Plan ruft, sind Vorwürfe der Duldung
oder Förderung bestimmter politischer Anschau
ungen oder Bekenntnisse – „Rechtslastigkeit“.
Sie eignen sich in ihrer Unbestimmbarkeit immer
für Schlagzeilen, reflexhafte Empörung und po
litische Polemik. Niemals konnte nachgewiesen
werden, dass in den Streitkräften jemals ein hö
heres Maß an staatsgefährdender Gesinnung oder
Betätigung herrschte als an Gymnasien, Univer
sitäten, in Werkhallen oder Behörden. Dennoch
haften ihnen seit den Zeiten sowjetischer Propa
ganda gegen die Wiederbewaffnung derlei latente
Verdächtigungen an. Oft gelten die durch irgend
Der Soldat soll sich
im Dienst weder
zugunsten noch
zuungunsten einer
politischen Richtung
betätigen.
Niemals konnte nachgewiesen werden, dass in
den Streitkräften jemals ein höheres Maß an
staatsgefährdender Gesinnung oder Betätigung
herrschte als an Gymnasien, Universitäten, in
Werkhallen oder Be
hörden.
JÜRGEN REICHARDT
welche Anlässe ausgelösten Kampagnen letztlich
der jeweiligen Regierung, die für das innere Gefü
ge der Streitkräfte verantwortlich ist. Wiederholt
hat sich aber die Führung selbst, wie gerade ak
tuell, öffentlich auf die Seite der Kritiker gestellt,
was die Truppe außerordentlich befremdet.
Die Verallgemeinerung einzelner Vorfälle ver
kennt die ethischen Grundlagen unserer Streit
kräfte und führt zu kränkenden Vorurteilen. Der
Soldat soll „Deutschland treu dienen“. Er soll das
Recht und die Freiheit des „Deutschen Volkes“
verteidigen. Das entstammt dem Wortschatz des
Grundgesetzes.Ist,werdaswörtlichnimmt,rechts
radikal? Der Soldat – somit auch der Vorgesetzte
– soll sich im Dienst nicht zugunsten, aber auch
nicht zuungunsten einer „politischen Richtung“
betätigen. Daraus hat sich die Zurückhaltung der
Vorgesetzten in Fragen politischer Anschauun
gen entwickelt. Gilt das als „Führungsschwäche“
bestimmter „Ebenen“? In der politischen Bildung
lernt der Soldat, dass nicht Gesinnungen strafbar
sind, sondern Handlungen, Taten. Soweit poli
tische oder weltanschauliche Ansichten nicht in
Konflikt mit den Grundpflichten nach dem Sol
datengesetz geraten, kann eine vorsorglicheMelde
pflicht über bedenkliche Meinungen, wie sie jetzt
verlangt worden ist, ernstlich nicht gefordert wer
den. Eine Armee, in welcher Gesinnungsschnüf
felei und Denunziantentum zur Führungskultur
gehören, kann auf Kameradschaft, selbstständiges
Handeln im Sinne des Ganzen und Vertrauen in
Vorgesetzte wie Untergebene vollständig verzich
ten. Was sie dann taugt, ist eine andere Frage.
Generalmajor a.D. Jürgen Reichardt
war vor
seiner Pensionierung im Jahr 1998 Amtschef des
Heeresamts in Köln. In seinem Ruhestand ist er als
Autor tätig.
Der Artikel erschien am 20. Mai 2017 im
„Straubinger Tagblatt“.
Foto: Bundeswehr/Twardy
der zuständige Disziplinarvorgesetzte habe nicht
sachgerecht gewürdigt und entschieden oder nicht
pflichtgemäß ermittelt. Ein Vorgesetzter, der das
täte, verletzte seine Pflichten. Zuweilen wird ange
nommen, bei frühzeitiger Kenntnis hätten höhere
Stellen auf Dienstvergehen anders, also strenger,
reagiert. Das kann zutreffen und lässt sich prüfen.
Außer Acht bleiben darf jedoch nicht, daß der Dis
ziplinarvorgesetzte stets verpflichtet ist, auch die
Persönlichkeit des Beschuldigten zu würdigen und
zu prüfen, inwieweit erzieherisch anstatt repressiv
vorgegangen werden kann. Das unterscheidet die
WDO vomWehrstrafgesetz.
Alle höheren Vorgesetzten, die durch diese
Schule gegangen sind, dürften für sachgerechte
Entscheidungen der Disziplinarebenen das nöti
ge Verständnis aufbringen, auch wenn ein Vorfall
spektakuläre Reaktionen auslöst und eine Ent
scheidung nicht den Erwartungen der Öffent
lichkeit entspricht. Eine „Führungsschwäche“
liegt darin nicht. Solches Verständnis als „Korps
geist“ zu beschreiben zeugt von Unkenntnis un
seres Disziplinarwesens, das schließlich auf dem
Soldatengesetz fußt, dieses auf dem Grundgesetz.
Dass Meldungen über besondere Vorkommnis
se gelegentlich unterbleiben, weil die Tragweite
DIE BUNDESWEHR | JULI 2017
T I T E L : B E R U F S E T H O S 25
















